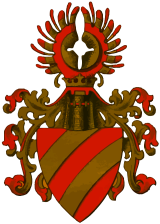Die Berufsbezeichnung „Roomfaßlamoan“ wird man wohl äußerst selten in den Aufzeichnungen der Kirchenbücher finden. Es handelte sich in den allermeisten Fällen nur um eine nebengewerbliche Tätigkeit, die von Bauern oder ehemaligen Waldarbeitern ausgeübt wurde, um sich etwas dazu zu verdienen. Das Handwerk gab es schon im Mittelalter, die zunehmende Industrialisierung machte diesen Berufszweig jedoch überflüssig. Der letzte „Roomfaßlamoan“ der Grafschaft Glatz gab vermutlich irgendwann zwischen den Weltkriegen sein Handwerk auf.
Wörtlich aus der glätzischen Mundart übersetzt bedeutet der Begriff Room-faßla-moan: Kienspanruß-fässchen-mann. Es war also ein Mann, der Fässchen mit Kienspanruß feilbot. Kienspäne bestehen aus Nadelholz, die auf natürliche Weise mit Harz durchtränkt sind, wodurch sie sehr gut und lange brennen. Der fette Kienruß wurde in der Grafschaft Glatz “Room” genannt. Andernorts nannte man diese Leute auch Rußbrenner. Die Tätigkeit wurde beispielsweise auch in Böhmen, Sachsen und im Schwarzwaldgebiet ausgeübt, eben dort, wo es ausgedehnte Wälder mit Nadelgehölz gab.
Ähnlich wie ein Köhler brannte der Rußbrenner Hölzer in einem Ofen mit kontrollierbarer Luftzufuhr sehr langsam ab. Während ein Köhler das Holz von Buchen, Eichen, Eschen und Birken verwendet um Holzkohle zu erhalten, nahm der Rußbrenner die sehr harzreichen Wurzelstöcke von abgeholzten Kiefern und Fichten, manchmal auch Reisig und Zapfen. Das gewünschte Endprodukt war hier ein sehr feiner und tiefschwarzer Ruß (feinste Teile reinen Kohlenstoffs), der als Rohstoff weiterverkauft wurde.
Die größeren Brennofen waren in etwa zehn bis zwölf Meter lang, drei Meter breit und zwei bis drei Meter hoch. Der Rauch der verkohlenden Wurzelstöcke wurde durch einen Sack gefiltert, in dem sich der Ruß absetzte. Auch wurde er nach dem Brennvorgang von den Innenwänden gefegt und gesammelt.
Die 18 bis 25 cm langen, leicht bauchigen Fässchen wurden in Heimarbeit aus sechs oben und unten schmaler zulaufenden Spanbrettchen hergestellt, die mit dünnen Holzbändern oder Ruten zusammengebunden wurden. Der Durchmesser betrug ungefähr 5 cm. Mit Bindfaden fixierte Leinwandläppchen verschlossen die Enden.

Der Roomfaßlamoan machte zweimal im Jahr meist mit einem zweirädrigen Handkarren seine Runde durch die Ortschaften – einmal im Frühjahr und einmal im Herbst.
Er bot entweder allein seine Waren feil, oder er wurde von seiner Frau begleitet. Manchmal wurde der Karren durch einen Hund gezogen. Der Wagen war hoch beladen mit seinen gebündelten kleinen „Faßlan“, einige hundert auf einer Fuhre. Oft war er tagelang unterwegs. Das Holzspan-Fäßchen kostete das Stück von einem „Sechser“ (ein 5 Pfennigstück) bis zu einem „Bihma“ (10 Pfennige).
Seine Kunden waren die Einwohner und Handwerker der Ortschaften, sowie die Krämerläden, wo man die „Fässel“ bei Bedarf kaufen konnte, solange der Lagerbestand reichte.
Die Verwendungsmöglichkeiten waren vielseitig:
- Nach dem Weißen der Stube brachte der Maler am unteren Teil der Wand durch Beimischung von Kienruß einen schwarzen Kehrstreifen an.
- Man benützte den Ruß auch zum Schwärzen von Ofentüren und Ofenrohren.
- “Schukschmere” (Schuhwichse / Stiefelschmiere / Lederfett): Man vermischte im besten Falle den Kienruß mit Schweineschmalz und erhielt so eine Paste, die die Schuhe schwärzte und wasserdicht machte. In der Realität bildeten neben dem Ruß meist Fettabfälle, ranzig gewordene Butter, Fischtran, etwas Rübensaft, Talglicht- und Wachskerzenreste die wohl nicht so wohlriechende Grundlage. Jeder Haushalt stellte seine eigene Schuhcreme selber her.
- Schuhmacher und Sattler stellten Lederschmiere her, Drechsler eine schwarze Politurfarbe, Silberschmiede verwendeten eine selbst hergestellte Paste zum Polieren und Dekorieren von Silberschmuck.
- Aus Schellack, Terpentin, einem erdigen Bestandteil (z. B. Magnesia oder gebrannter Gips), einem ätherischen Öl und einem färbenden Bestandteil wurde Siegellack hergestellt. Durch die Zugabe von Ruß erhielt man schwarzen Siegellack. Die zusammengeschmolzene gut vermengte Masse goss man in geölte Formen, wo sie zu den bekannten Stangen erstarrten.
- Tusche fertigte man aus Ruß, Öl und tierischem Leim.
- Um Druckerschwärze zu erhalten, wurden Leinölfirnis und Ruß fein zusammengerieben, dann auf eine Steinplatte aufgetragen und mit einer Walze z.B. auf die gesetzten Lettern aufgetragen.
- Weitere Verwendungen: Schwarze Ölfarbe, Abdichtungsmaterial für Schiffsrümpfe
Quellen:
Bartsch, Alois. Der „Roomfaßlamoan“ in: Ostdeutsche Heimat. Häämtebärnla. Für Glatzer u. Adlergebirgler. 3. Jahrgang. S. 72ff. 1951
Eschner, Max. Natur und Menschenhand im Dienste des Hauses. Unsere wichtigeren Bedarfs- und Gebrauchsgegenstände nach ihrer Entstehung und Herkunft. 2. Band. Hobbing & Büchle. Stuttgart. 1898