Franz Josef Birke ist mein Urgroßvater in der väterlichen Linie. Er war eines von 10 Kindern. Die Familie lebte in Goldwasser einem kleinen Wohnflecken im Beutengrund nördlich von Königswalde.

In den Familienunterlagen waren zwei Fotos: das erste zeigt Franz Birke als jungen Burschen in Uniform und das zweite bei seiner Hochzeit mit seiner Frau Anna Teuber. Diese frühen Fotos machten neugierig und warfen Fragen auf; einige Antworten möchte ich in diesem Beitrag vorstellen.

Jugendbild
Franz hat auf diesem Bild eine einfache Felduniform an. Da keine weiteren Rangabzeichen zu
erkennen sind, scheint er den niedrigsten Dienstrang der Mannschaften zu führen – also
bspw. Schütze, Füsilier, Grenadier. Auf der Schulterklappe ist eine „11“ zu erkennen.
Das ist ein Hinweis auf das Regiment, in dem Franz „diente“. Im Raum Glatz / Neurode gab es zwei Regimenter mit der „11“: das 2. Schlesische Grenadier-Regiment Nr. 11 und das 4. Niederschlesische Landwehrregiment Nr. 11. Wahrscheinlich gehörte er zunächst zum letzteren, da die Landwehrverbände aus Militärpflichtigen gebildet wurden.
Damit können wir das Datum der Erstellung des Fotos enger eingrenzen. Die Militärpflicht hatte Franz 1862 (Geburtsjahr 1845 + 17 Jahre) erreicht. Die Aufnahme stammt also aus den Jahren ab 1862.
Nehmen wir das Landwehrregiment 11 als „seinen“ Truppenteil an, so wird er wahrscheinlich zu dessen 1. Bataillon in Glatz gehört haben. Dieses Bataillon war nämlich für die Aufnahme der Militärpflichtigen aus den Kreisen Glatz, Habelschwerdt und nach Bildung des Kreises Neurode im Jahr 1868 für diesen Regionalbereich zuständig. (s. auch: http://genwiki.genealogy.net/LIR_11)
Exkurs: Militärpflicht
Die Militärpflicht eines jungen Mannes begann mit 17 Jahren und endete mit 40 Jahren. Eingezogen werden konnte er ab 20 Jahren, vorher war eine Freiwilligenmeldung möglich. Die aktive Dienstpflicht dauerte bis zu 2 Jahren. „Einjährig Freiwillige“ konnten sich ab 17 Jahren zum Dienst melden und wurden je nach Eignung und Vorbildung für Laufbahnen in der Gruppe der Feldwebel der Reserve oder auch Offiziere vorgesehen. Außerdem konnte man sich nach der aktiven Dienstpflicht in verschiedenen Jahresschritten weiterverpflichten und erhielt dann den Status eines „Kapitulanten“. Diese konnten dann je nach Eignung und
Ausbildung höhere Dienstgrade in der Gruppe der Unteroffiziere und Feldwebel erreichen.
Hochzeitsfoto
Auf diesem Fotos steht ein stolzer Franz in Paradeuniform neben seiner Frau Anna. Die Paradeuniform war sehr farbig in der Ausstattung, was leider bei dem Schwarz-Weiß-Foto nicht so recht deutlich wird.
Ein besonderes Merkmal dieses Anzuges ist der Helm mit dem Paradebusch.
Ein Blick auf die Farbe der Hose verrät die Jahreszeit: dunkel = Winterhalbjahr und weiß = Sommerhalbjahr.
Da die Hochzeit im November 1871 stattfand, ist die Hosenfarbe
logischerweise dunkel.

Aber nun zur Uniformjacke selbst. Folgende Merkmale sind auffällig: Um den Kragenrand sehen wir eine breite Tresse aus Silber- oder Goldmetall und die Ärmelaufschläge mit drei Knöpfen. Man nennt diese Art „französische Aufschläge“, erkennbar durch die waagerechten Doppelbänder an jedem der drei Knöpfe. Zusammengenommen lässt dieses auf den Dienstgrad eines Unteroffiziers schließen. Ein höherer Dienstgrad ist ausgeschlossen, weil dazu die Knöpfe am Kragen und ein Doppelarmband unter den Ärmelaufschlag fehlen.
Ein noch nicht beschriebenes Merkmal der Uniform weist auf den militärischen
Einsatzbereich des Franz hin: Es ist das senkrecht gestreifte „Schwalbennest“ auf der linken Achsel! Dieses trugen Soldaten, die in irgendeiner Form mit Militärmusik zu tun hatten. Dazu gehörten Angehörige der Musikkapellen, Spielleute, aber auch Trompeter und Hornisten, die bei Übungen und Gefecht Signale zu übermitteln hatten.
Eine Zuordnung zu einem Regiment ist leider nicht erkennbar.
Historischer Hintergrund
Um die Aussagen der beiden Bilder noch besser zu verstehen, muss auch ein Blick auf den historischen Hintergrund geworfen werden.
Mitte des 19. Jahrhunderts war Preußen, zu dem ja damals die Grafschaft Glatz gehörte, in mehrere Kriege verwickelt:
1864
1866
1870 / 71
Deutsch-dänischer Krieg
Preußisch-Österreichischer Krieg
Deutsch-französischer Krieg
Deutsch-dänischer Krieg
Am 01.02.1864 begann der Krieg als 40.000 preußische und 20.000 österreichische Soldaten unter dem Kommando des Generalfeldmarschalls Wrangel die Eider überschritten, um Schleswig zu besetzen. Am 30. Oktober 1864 endete der Krieg mit dem Frieden von Wien.
Gemäß zeitgenössischer Aussagen waren alle Soldaten zu Weihnachten 1894 wieder zu Hause.
Mit dabei waren niederschlesische Regimenter, die natürlich auch den An- und Rückmarsch zu bewältigen hatten. Eisenbahnlinien zum Transport gab es auf den Hauptstrecken (s. Eisenbahnkarte von 1861). In welchem Umfang das verfügbare Eisenbahnnetz genutzt wurde, ist mir nicht bekannt. Vieles musste daher zu Fuß und der Materialtransport mit Pferdefuhrwerken erledigt werden.
Die Entfernung Glatz – Schleswig beträgt ca. 800 km. Damals konnten Eisenbahnzüge etwa 50 km/h erreichen, dazu kamen entsprechende Zeiten für Kohle- / Wasserübernahme und Wartungsarbeiten für die Dampflokomotiven. Da die Garnisonen der eingesetzten Truppenteile, bzw. deren Einsatzräume nicht immer in der Nähe von Bahnhöfen lagen, mussten diese Strecken zu Fuß überwunden werden. Die durchschnittliche Marschleistung für die Infanterie lag bei etwa 20 – 25 km/Tag plus Ruhetage. Der Aufmarsch, der wegen der „Verkehrsverbindungen“ durch Altona führte – damals wie heute ein bedeutender Eisenbahnknoten, hatte wahrscheinlich schon im Dezember 1893 begonnen.
Preußisch-Österreichischer Krieg
Dieser Krieg fand in der Zeit 14.06 – 23.08.1866 statt. Die entscheiden Schlacht bei
Königsgrätz fand unter Beteiligung von Verbänden aus Niederschlesien, sozusagen nach an der „eigenen Haustür“ der Grafschaft Glatz in der Nähe der Stadt Nachod (Böhmen) statt.
Exkurs: Königswalder Chronik
Die Königswalder Chronik auf Seite 11 berichtet von Durchmärschen großer Truppenverbände zu diesem Schlachtenort: ” … Auch unser Dorf bekam solche und zwar zuerst Jäger, dann Infanterie, dann grüne Husaren, und zwei Mal eine Abteilung vom Train. Durchmärsche geschahen öfters, das eine Mal, den 29.Mai, dauerte der Durchmarsch von früh ungefähr 7 Uhr ab bis beinahe gegen Mittag und waren dabei bereits alle Truppengattungen vertreten. …”
Deutsch-französischer Krieg
Dieser Krieg fand vom 19.07.1870 – 10.05.1871 statt. Beteiligt waren wieder Truppenteile aus Niederschlesien, wovon Teile auch in Paris an der Siegesparade teilnahmen.
Exkurs: Königswalder Chronik
Die Chronik von Königswalde berichtet auf der Seite 23 von 8 Gefallenen aus dem Ort und der Umgebung. Einige von diesen gehörten dem Infanterie-Regiment Nr. 11 (Glatz) an.
Beteiligte Verbände aus Niederschlesien
Die Verlustlisten aus den letzten beiden Kriegen sind sehr aufschlussreich. Sehr häufig wird dort das 2. Schlesische Grenadier-Regiment Nr. 11 als Truppenteil genannt, aus dem die Verwundeten, Vermissten und Gefallenen stammten. Diese wiederum kamen fast ausnahmslos aus Orten der Grafschaft Glatz.
Fazit
Betrachtet man das „Jugendbild“ des Franz vor dem historischen Hintergrund, so kann man davon ausgehen, dass er als junger dienstpflichtiger Soldat bei dem deutsch-dänischen Krieg dabei war, denn nur so konnte er in Uniform von dem Fotografen Gustav Hager (St. Pauli, Langereihe) fotografiert worden sein. Die Straße „Langereihe“ war im Ortsbereich St. Pauli und stellte die Verbindung zwischen Reeperbahn und dem Nobistor her. In zeitgenössischen Karten Altonas aus dem Jahr 1890 ist sie noch eingezeichnet. Heute gibt es diese nicht mehr.

Franz wird sich wahrscheinlich verpflichtet haben und „Kapitulant“ geworden sein. Dafür spricht der weitere Werdegang zum Unteroffizier. Der Status eines „Einjährig-Freiwilligen“ ist auszuschließen, da er die dafür den notwendigen Schulabschluss in Königswalde nicht erreichen konnte. Sicherlich wird er aber nicht mehr im Landwehr-Regiment 11, sondern nun in einem „aktiven“ Verband, vermutlich Grenadier-Regiment Nr. 11, gewesen sein. Für dieses Regiment ist die Teilnahme an den beiden Kriegen gegen Österreich und Frankreich auf Grund der Auswertungen der Verlustlisten belegt. An dem deutsch-dänischen Krieg waren auch Verbände aus Niederschlesien im Rahmen der 21. Infanterie-Brigade (verm. Schweidnitz) beteiligt. Dazu gehörte u.a. das 1. Schlesische Grenadier-Regiment Nr. 10.
Diesem waren wahrscheinlich Reservekräfte aus dem „benachbarten“ 2. Schlesischen
Grenadier-Regiment Nr. 11 der 22. Infanterie-Brigade (Breslau) zugeordnet worden. Daher greift auch unser Franz „ins Weltgeschehen“ ein.
Exkurs: Ausbildung zum “Einjährig-Freiwilligen”
Der Ausbildungsgang zum “Einjährig-Freiwilligen” wurde um 1900 durchlässiger gestaltet. Es gab die Möglichkeit an einem Fernkurs teilzunehmen und die notwendige Qualifikation zu erwerben.

In dem Heiratseintrag von Franz und Anna steht als Berufsbezeichnung seines Vaters Josef Birke noch „Gärtner“. Damit dürfte dieser den Hof zu dieser Zeit noch nicht an seinen ältesten Sohn Franz übergeben haben. Ob Franz zum Zeitpunkt der Hochzeit noch aktiver Soldat war oder den Status eines Reservisten, ist auf Grund der vorhandenen Unterlagen nicht mehr festzustellen. Ich vermute aber, dass er wieder „Zivilist“ war. Als aktiver Soldat eines Regimentes wäre m. E. der Traueintrag in den Unterlagen des Regimentes zu suchen gewesen.
Ob Franz auch an den anderen beiden Kriegen teilgenommen hat, ist leider nicht überliefert, aber zu vermuten.
Das „Hochzeitsfoto“ verrät uns die Funktion, die er wahrscheinlich in dem Regiment
wahrgenommen hatte: Das „Schwalbennest“ deutet auf seinen Einsatz als Trompeter oder Hornist hin, der die Aufgabe hatte, mit entsprechenden Signalen die Kommandos an die Truppen während Übungen und Schlachten zu übermitteln. Da hierzu eine besondere Ausbildung notwendig war, ist wohl auch der Dienstgrad eines Unteroffiziers begründet. Für diese wichtige Aufgabe wurden sicherlich nicht die „Dümmsten“ ausgesucht.
Seine “musikalische Ader” scheint er weitervererbt zu haben, denn sein Sohn Reinhold hat eine ähnliche Laufbahn eingeschlagen – doch das ist eine andere Geschichte.
Für das Hochzeitsfoto in Uniform gibt es aus meiner Sicht zwei Gründe: Es ist der Stolz auf die kürzlich errungenen Siege und das eigene Zutun dabei.
Ein junger Mann hatte in der Regel nicht die Mittel für einen „feinen Anzug“, also nahm man das, was verfügbar war – nämlich die Uniform, die man als Reservist oder aktiver Soldat noch hatte.
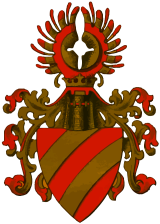
Eine Antwort auf „Zwei Fotos …“
Lieber Alfred, Du bist ein Fuchs.
Sehr schöne Zusammenstellung, die ich nun schon zum 2. mal gelesen habe.
So alt wie ich bin – Bilder interessieren mich immer besonders – lese ich sie mit etwas Abstand womöglich noch ein drittes Mal….;-)