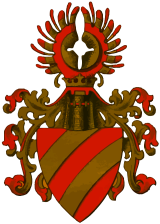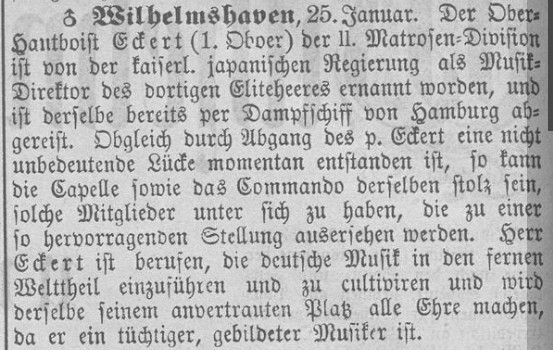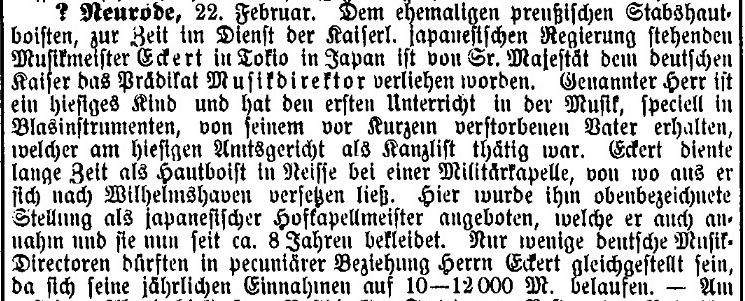Franz Eckert wurde am 5. April 1852 in Neurode geboren. Sein Vater Franz (1804–1885) war Gerichtskanzlist, seine Mutter die Tochter eines Tischlermeisters. Er war das letztgeborene von acht Kindern, von denen vier bereits früh verstarben. Als er 15 Jahre alt war starb die Mutter Amalia geb. Klar (Kath. KB Nr. 142/1867).
Seinen ersten Musikunterricht erhielt er von seinem Vater, der Leiter einer Musikkapelle war. Die Kapelle bestand zum Großteil aus gedienten Militärmusikern, die nun einen zivilen Beruf ausübten. Sie spielten sowohl zum Tanz, als auch bei Begräbnissen auf. Außerdem war der Vater sowohl Mitglied, als auch Musiklehrer für Blasinstrumente im Cäcilienverein (Verein zur Förderung der katholischen Kirchenmusik).
Die weitere musikalische Ausbildung erhielt er an den Konservatorien in Breslau und Dresden.
Wie sein Bruder Wenzel (1846 – 1901) wurde Franz Eckert Militärmusiker. In Neisse, wo er als Hilfs-Hautboist Dienst tat, lernte Eckert das gleichaltrige Hausmädchen Mathilde Huch kennen. Sie heirateten 1875 in ihrem Heimatort Falkenau bei Neisse. Beide waren katholischer Religion.
Die älteste Tochter Amalie wurde ein Jahr später in Wilhelmshaven geboren, wo Eckert drei Jahre lang im Musikcorps der 2. Kaiserlichen Matrosen-Division diente, nun als Ober-Hautboist. Die zweite Tochter Johanna Cäcilie wurde ebenfalls hier geboren, starb jedoch im Alter von neun Monaten (StA Falkenau Nr. 20/1879). Das Paar hatte insgesamt sieben Kinder. Drei Söhne und drei Töchter erreichten das Erwachsenenalter.
Eigentlich sollte Eckerts Kapellmeister nach Japan geschickt werden. Als dieser jedoch ablehnte, bekam Franz Eckert den Posten.
Während Eckert sich 1879 allein von Hamburg nach Japan einschiffte, um seine Aufgabe bei der Marinekapelle Tokio anzutreten, kehrte seine schwangere Frau nach Neurode zurück, wo der älteste Sohn Franz zur Welt kam.
Der pensionierte Kanzelist Franz Eckert zeigte die Geburt seines Enkels Franz August am 23.09.1879 an. Der Beruf des Kindsvaters ist als „Kapellmeister in der Japanesischen Marine in Tokio“ angegeben (StA Neurode Nr. 206/1879 und Kath. KB Nr. 393/1879).
In Tokio erhielt Eckert die Aufgabe, eine Nationalhymne zu komponieren. 1880 uraufgeführt, ist das „Kimi Ga Yo“ auch heute noch die offizielle Nationalhymne Japans.

Er unterrichtete die ihm unterstellten Musiker im Gebrauch der deutschen Instrumente und vermittelte ihnen westliche Harmonien und Melodien, besonders der deutschen Militärmusik, die noch weitgehend unbekannt waren.
17 Mitglieder der kleinen deutschen Gemeinschaft in Tokio gründeten 1880 einen Gesangverein und Eckert übernahm die Aufgabe des Dirigenten. Man traf sich wöchentlich und trat auch gelegentlich bei Konzerten auf. Neben dem Gesang legte man wohl auch viel Wert auf das gesellige Beisammensein.
Ca. 1882 traf seine Frau mit den Kindern in Japan ein. Die weiteren Kinder Anna-Irene (Mai 1883), Karl, Georg und Elisabeth (1887) wurden in Tokio geboren.
Er nahm parallel mehrere Aufgaben, unter anderem bei der Hofkapelle an und wurde mit verschiedenen Kompositionen beauftragt, unter anderem mit dem Trauermarsch Kanashimi no kiwami (Unermesslicher Schmerz) anlässlich der Beerdigung der Mutter des Tennos, Eishō (1835 – 1897), das bei ähnlichen Anlässen auch heute noch gespielt wird.
1888 erhielt er den Titel „Königlich-Preußischer Musikdirektor“ vom Preußischen König.
1889 endete nach mehreren Verlängerungen Franz Eckerts Tätigkeit für das Marineministerium und 1899 sein Wirken in Japan nach 20 Jahren. Die Familie kehrte nach Deutschland zurück, wo er wenige Monate in Bad Sooden bei der Kurkapelle arbeitete.
Schon Ende 1900 reiste Franz Eckert nach Korea und wurde Kapellmeister am Hof des Kaisers. Die Kaiserliche Militärkapelle unter seiner Leitung spielte häufig in Gegenwart des Kaisers. Auch in Korea erhielt er den Auftrag zur Komposition einer Nationalhymne.
Mehrfach wurde sogar in einer deutschsprachigen Zeitung in Amerika über ihn berichtet.
Ab 1902 war die Familie wieder bei ihm in Korea vereint. Sie waren regelmäßige Kirchgänger und seine Töchter heirateten in der Kathedrale in Seoul. Die Familie hatte ihren Wohnsitz im eher ländlichen Außenbezirk. Die Töchter sprachen mehrere Sprachen und spielten Instrumente.
1910 wurde die koreanische Nationalhymne im Zuge der Annexion Koreas durch Japan verboten. Stattdessen wurde sie durch die von Franz Eckert komponierte japanische Hymne ersetzt. Nach der Befreiung Koreas wurde ein Musikstück eines koreanischen Komponisten als neue Hymne gewählt.
Ende 1915 musste Eckert aus gesundheitlichen Gründen seine Tätigkeit aufgeben und starb am 6. August 1916 in seinem Haus in Keijō, (Seoul, Korea unter japanischer Herrschaft) an Magenkrebs.
Trotz der Kriegszeiten wurde er mit allen Ehren seitens der Koreaner und Japaner auf dem Ausländerfriedhof in Seoul beigesetzt. Bei seiner Beerdigung spielte die von ihm gegründete Hofkapelle.
Franz Eckerts Beitrag zur freundschaftlichen musikalischen Völkerverständigung zwischen Deutschland, Japan und Korea ist auch nach über 100 Jahren noch nicht in Vergessenheit geraten.
Seine Frau blieb noch bis 1920 in Korea und kehrte dann nach Deutschland zurück. Sie starb 1934 in Sudoll, Kreis Ratibor, wo der Sohn Karl als Volksschullehrer arbeitete.
Stammbaum-Diagramm Familie Franz Eckert
Quellen und weiterführende Links: